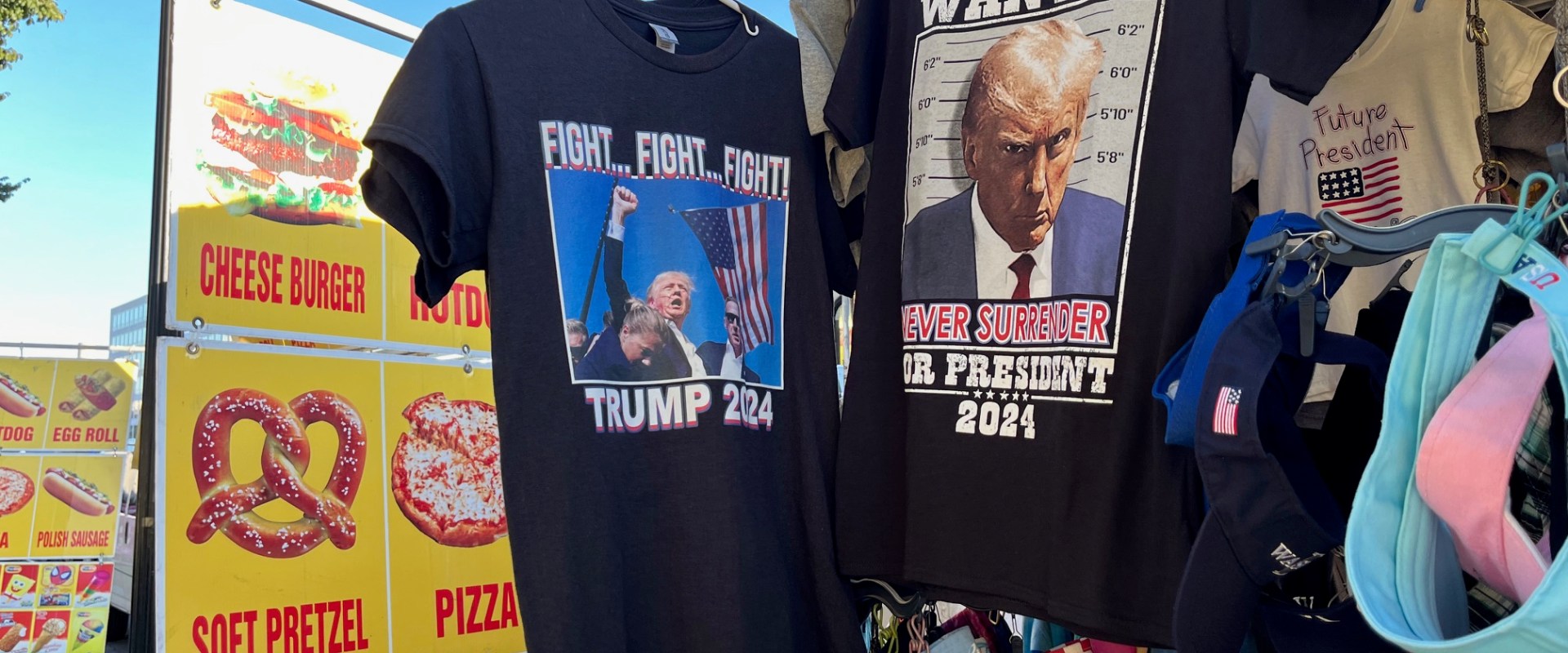Vereinte Nationen in der Krise: Braucht die Welt die UNO noch? – FALTER
Die Alpenrepublik will in der UNO mehr zu sagen haben. Nicht ganz so viel wie in der Zeit Kurt Waldheims, der zwei Amtszeiten UNO-Generalsekretär war, bevor er wegen Lügen zu seiner Kriegsvergangenheit in Nazideutschland zu einem Symbol des Vergessens wurde. Aber wenn alles nach Wunsch der Regierung geht, kann es gut sein, dass die Außenministerin oder der Außenminister der Republik im UNO-Sicherheitsrat in New York in Zukunft einmal den Vorsitz führt.
Die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen werden fünf neue Staaten in den UNO-Sicherheitsrat wählen. Fünf Großmächte haben einen permanenten Sitz im wichtigsten UN-Gremium. Die nicht-ständigen Mitglieder wechseln nach einem geografischen Rotationsprinzip alle zwei Jahre. Österreich bewirbt sich für 2027 und 2028. Die Bewerbung wird unser Land zwingen, klarer als bisher zu Fragen der globalen Politik Stellung zu beziehen. Das ist zu begrüßen.
Die Freiheitlichen protestieren, weil 20 Millionen für die Lobbyingkampagne vorgesehen sind. Die Abgeordnete Susanne Fürst hält es für nötig über Champagner in New York zu schimpfen. Dass einer von der FPÖ erträumten Festung Österreich egal sein kann, was sich im Rest der Welt tut, glaubt sie wohl selbst nicht. Für die Regierung ist unsere Neutralität ein Verkaufsargument. Verteidigungsministerin Claudia Tanner verweist darauf, dass das Bundesheer in fünf von 11 UNO-Friedensmissionen beteiligt ist. Allerdings ist der schmähliche Abzug vom Golan 2013, weil es gefährlich wurde, noch in Erinnerung. Das Pochen auf ein Neutralitätskonzept aus einer anderen Epoche wird für die Positionierung Österreichs nicht ausreichen.
Die Weltorganisation befindet sich in einer schwierigen Phase. Die UNO spielt in den großen Kriegen unserer Zeit keine Rolle. Weder für Gaza noch die Ukraine oder für den Sudan gibt es Lösungen. Das Gewicht des Völkerrechts geht zurück. Die imperialistischen Impulse von Großmächten beschädigen internationale Organisationen, von denen hunderte Millionen Menschen abhängen. Donald Trump hat die amerikanischen Zuwendungen zum Welternährungsprogramm und der Weltgesundheitsorganisation reduziert. Die UNO gehört zu den Feindbildern der Machthaber im Weißen Haus.
Die Schwächung der UNO steht in eklatantem Widerspruch zu den globalen Problemen, die selbst die mächtigsten Supermächte nicht alleine angehen können. An erster Stelle ist der Klimawandel zu nennen. Der von der UNO getragene Prozess seit dem Pariser Klimaabkommen hat die weltpolitischen Turbulenzen überlebt. Glücklicherweise. Ungeduldigen Aktivisten sind die endlosen internationalen Konferenzen fremd. Die Realität ist jedoch, dass das globale Klima durch internationale Abkommen zwischen Staaten beeinflusst wird, nicht durch die Verhaltensänderung Einzelner, die auf ihren CO2-Fussabdruck achten. Ohne die Vereinten Nationen ist sinnvolle Klimapolitik unmöglich.
Die amerikanischen Politikwissenschaftler Stewart Patrick und Minh-Thu Pham haben recherchiert, wie die Welt zum ungeliebten Multilateralismus steht. Sie kommen zum Schluss, dass die überwiegende Mehrheit der Staaten das System der Abkommen und internationalen Regeln trotz aller Lücken beibehalten will. Der UNO-Experte Richard Gowen sieht sogar in der häufigen Blockade des Sicherheitsrates durch ein Veto der Rivalen USA und Russland kein Desaster. In den schwierigen Phasen des Kalten Krieges war der Sicherheitsrat häufig blockiert. Aber die Supermächte wussten, dass sie jederzeit die Möglichkeit hatten über die UNO den Hebel in Richtung Entspannung umzulegen. Solche bewährte Mechanismen müssen auch in der Epoche der Trumps, Putins und Xis bewahrt werden.
Österreich wirbt um Stimmen für den Sicherheitsrat in einer Situation, in der die Gegensätze zwischen dem globalen Süden und dem westlichen Norden genauso schwer wiegen wie zwischen Ost und West. Die Vorstellung eines Kampfes zwischen Demokratien und den aufsteigenden autoritären Systemen ist durch Trump entsorgt worden. Brasilien, Südafrika, Indonesien und andere Schwergewichte in Lateinamerika, Afrika und Asien reagieren empört, dass der Westen bei fortlaufenden Kriegsverbrechen in Gaza wegschaut, aber Solidarität gegen Russlands Ukrainekrieg fordert. Dass Österreich in der EU zum proisraelischen Flügel gehört und sogar eine diplomatische Anerkennung Palästinas verweigert, wird registriert. Bei Klimaverhandlungen stehen wirtschaftliche Fragen im Vordergrund, bei denen die Wiener Regierung die harte Verhandlungstaktik der Europäischen Union mitträgt.
Eine Reform der UNO stand bei der Herbsttagung der Generalversammlung im letzten Jahr im Zentrum. Die USA pochen auf größere Effizienz und weniger Bürokratie. Der globale Süden will den dominierenden Einfluss der Großmächte von 1945 reduzieren. Brasilien, Südafrika, Indien und Deutschland drängen in den Reigen der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat.
Dass Österreich mit seiner in die Jahre gekommene Neutralität wirbt und Kanzler Stocker Wien als Veranstaltungsort anpreist ist schön und gut. Inhaltliche Impulse für die Vereinten Nationen in Richtung der Anforderungen des 21Jahrhuderts wären genauso wichtig.
ZUSATZINFOS
Die Architektur der UNO
Die Abstimmung über neue Sicherheitsratsmitglieder im Sommer 2026 ist geheim. Für zwei EU-Sitze rittern Österreich, Portugal und Deutschland. In der Generalversammlung sind 193 Staaten gleichberechtigt. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien haben Vetorecht. 10 Mitglieder wechseln. Österreich wäre ab 2027 zum vierten Mal vertreten
Ähnliche Beiträge